Die Berichte der Frankfurter Rundschau, 10.04.2008
von Matthias THIEME
"Ursachen von Not bekämpfen"
Herr Gebauer, die Spendenbranche reformiert sich nach dem Unicef-Skandal – wird jetzt alles gut?
Dass über Transparenz weiter nachgedacht wird, ist gut. Spender haben das Recht, zu erfahren, wie Hilfsorganisationen mit dem ihnen anvertrauten Geld umgehen. Problematisch ist es aber, wenn der Begriff der Transparenz auf die betriebswirtschaftliche Sphäre reduziert wird. Spannender ist es, Transparenz im politischen Kontext zu betrachten.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Es macht schon einen Unterschied, ob in Notsituationen schlicht Nahrungsmittel und Medikamente verteilt werden, oder die nachhaltige Überwindung von Not angestrebt wird. Organisationen, die auf langfristige Veränderungsprozesse Wert legen und mit lokalen Partnern zusammenarbeiten, haben es da schwerer als solche, die nur Hilfsgüter verteilen.
Wie könnte man politische Ziele transparenter machen?
Kirchliche Entwicklungsorganisationen haben in ihren Selbstverpflichtungen zur Transparenz das Ziel formuliert, für gerechte Gesellschaften einzutreten. Hier wird das betriebswirtschaftliche Geschehen den Absichten untergeordnet. Zum Bemühen um Transparenz gehört auch, die Ursachen offenzulegen, die der Bekämpfung von Not entgegenstehen. Deutlich wird dann, wie komplex das Umfeld von Hilfe ist und wie langwierig Veränderungen sind.
Was heißt das konkret?
Nehmen Sie unsere Kampagne gegen Landminen. Wir haben Menschen, die von Minen verstümmelt wurden, mit Prothesen geholfen. Aber zugleich haben wir politisch für ein Verbot von Minen gekämpft. Das hat sechs Jahre in Anspruch genommen. Schließlich haben mehr als 150 Staaten ein völkerrechtliches Verbot von Landminen unterzeichnet. Als wir mit der der Arbeit begannen, konnten wir aber nicht wissen, dass am Ende solch ein Erfolg stehen würde. So etwas kann man nicht vorher unter Effizienzkriterien planen.
Ist langfristige Hilfe besser?
Natürlich ist es wichtig, in akuter Not unmittelbar Hilfe zu leisten, aber man muss eben zugleich an den sozialen und politischen Ursachen ansetzen. Die Welt leidet ja nicht an zu wenig Hilfe, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen.
Was ist denn problematisch an kurzfristiger Hilfe?
Wenn Hilfsorganisationen sich darauf beschränken, von außen Hilfe überzustülpen, dann produzieren sie Abhängigkeit. Nach dem Tsunami haben wir das beobachten müssen. Betroffene, die gerade noch selbst bei Rettungs- und Aufräumarbeiten zugepackt hatten, wurden zu passiven Schlangestehern, als die Flut der Hilfsorganisationen eintraf. Letztlich hat das dazu geführt, dass etliche Menschen demoralisiert und in ihrem Selbstwertgefühl beeinträchtigt wurden. Das Verteilen von Hilfsgütern kann hochtransparent sein – und doch langfristig viele Probleme verursachen.
Müssten sich Hilfsorganisationen mit politischem Anspruch deutlicher abgrenzen?
Ja, sie sollte zumindest ihren Anspruch verteidigen. Denn wenn Transparenz auf betriebswirtschaftliche Aussagen reduziert wird, dann wächst die Gefahr, auch die Qualität der Hilfe nur noch an ökonomischen Kriterien zu messen. Dann verkommt Hilfe zu einer Ware.
Sind Organisationen mit einfachen Botschaften auf dem Spendenmarkt erfolgreicher?
Ja, leider. Die langfristige Entwicklungszusammenarbeit verliert an Bedeutung. Es profitiert die unmittelbare Nothilfe. Das Verständnis für die komplexen Umstände von Elend und Hilfe ist in der Öffentlichkeit verloren gegangen. Es ist höchste Zeit, sich wieder daran zu erinnern, dass Hilfe mehr ist als professionelles Fundraising, das nur ein "gutes Gefühl verkaufen" will. Das ist säkularisierter Ablasshandel. Wirksame Hilfe ist dagegen komplex, dringt auf Veränderungen und erfordert kritische Spender.
Online am: 10.04.2008
Aktualisiert am: 01.12.2015
Inhalt:
- Spendenskandal bei UNICEF: ein Überblick
- Auf 1 Blick: Ereignisse, Medien und Folgen
- Eine Chronologie aller Ereignisse von 2005 bis 2008 bei UNICEF
- UNICEF-Spendenskandal: ABC der Akteure
- Wie die Frankfurter Rundschau den UNICEF-Spendenskandal aufdeckte
- Der Redakteur Joerg SCHINDLER im Gespraech
Tags:
Frankfurter Rundschau | Köln | Matthias THIEME | Pressefreiheit | Selbstbedienung | Spenden | UNICEF

Auszeichnungen:
"Wächterpreis der Tagespresse" 2009
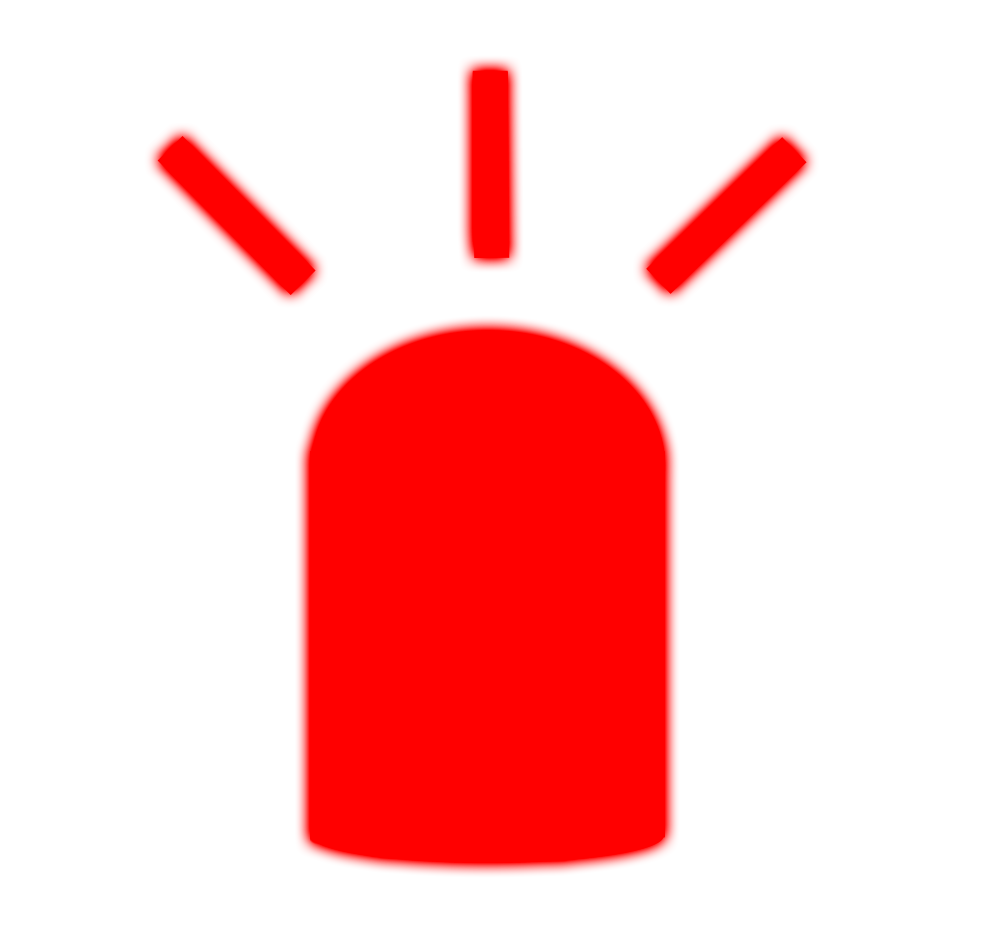
Whistleblower
Dies ist die Geschichte eines Whistleblowers
