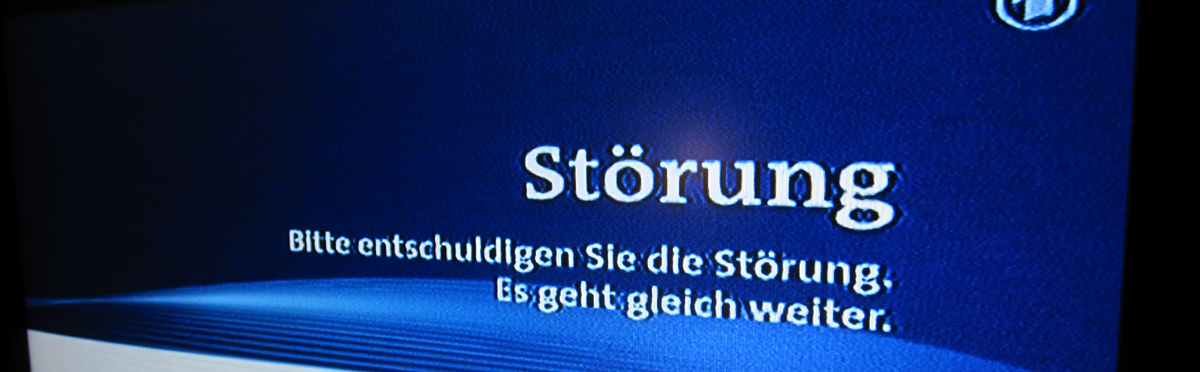
Rundfunkräte als "Medienwächter"? Oder: Kontrolle ohne Kontrolleure?
Der nachfolgende Text von Johannes LUDWIG war 2009 in dem Sammelband "Sind ARD und ZDF noch zu retten? Tabuzonen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk" (Hg. Johannes LUDWIG) erschienen (Nomos-Verlag, Baden-Baden) und geht hier in etwas veränderter Form online. Der Titel des Originalkapitels lautet: "Rundfunkräte als 'Medienwächter': zwischen Engagement und Überforderung. Oder: Kontrolle ohne Kontrolleure?"
Rundfunkratsmitglieder verstehen sich oft "als Statthalter ihrer Intendanten sowie ihrer Anstalt", heißt es in Dissertation aus dem Jahr 2009 von Caroline HAHN: "Die Aufsicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks". Und dies hier ist ein Beispiel:
Fall Hessischer Rundfunk

Wissenschaftler des Instituts für Kommunikationswisenschaft an der Uni München, Hans-Bernd Brosius, Patrick Rössler und Claudia Schulte zur Hausen, hatten im Herbst 1998 mit einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Untersuchung begonnen, die sich mit der „Qualität der Medienkontrolle“ beschäftigen sollte: "Ergebnisse einer Befragung deutscher Rundfunk- und Medienräte", erschienen in der Fachzeitschrift Publizistik im Jahr 2000 (S. 417-441). Konkret hatten die Medienforscher eine repräsentative Auswahl der deutschlandweit insgesamt 940 als Rundfunk- oder Medienrat tätigen Personen mit einem Fragebogen angeschrieben. Organisatorisch liefen die Anschreiben über die jeweiligen Büros dieser Gremien („Gremienbüros“). Auch beim Hessischen Rundfunk.
Der allerdings – angeführt von seinem Intendanten „Prof. Dr. Klaus Berg“– gedachte sich diesem Evaluierungsvorhaben zu versagen.
Dass sich der Intendant des Hessischen Rundfunks – selbst Mitherausgeber der so genannten Langzeit-Studie „Mediennutzung“ – einer wissenschaftlichen Studie Dritter verweigerte, ist der eine Aspekt. Die Münchner Medienwissenschaftler wollten konkret der Frage nachgehen, ob und inwieweit die in der (damals) aktuellen Diskussion geäußerten Befürchtungen zutreffend seien, die nachmittäglichen Talkshows im Fernsehen seien verroht, reißerisch und jugendgefährdend.
Der andere Aspekt ist in unserem Kontext aufschlussreicher:
- Das Anschreiben der Wissenschaftler richtete sich an den Rundfunkrat bzw. dessen Vorsitzenden. Also an jenen, der für die Kontrolle zuständig ist.
- Geantwortet hatte nicht der Angeschriebene, sondern der zu Kontrollierende, der Intendant:
- Er, der zu Kontrollierende, würde „in Übereinstimmung“ mit seinem Kontrolleur mitteilen,
- dass sich – nicht der Runfunkrat, sondern – der „Hessische Rundfunk“ als solcher daran nicht beteiligen werde.
Normalfall im Alltag des deutschen Rundfunkratswesens, jenem Gremium, das für das Programmgeschehen und der Verantwortlichen zuständig sein soll?
Im März 2004 kommt es – wiederum sind wir beim Hessischen Rundfunk – zu einem Eklat: der Sportchef des Hessischen Rundfunks, Jürgen Emig, tritt zurück. Freiwillig. Wenige Tage später heißt es in der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ aus Kassel: Der – inzwischen neue – Intendant „mistet mit eiserner Hand aus“.
Nochmals vier Jahre später, 2008, wird der ehemalige Sportchef des Hessischen Rundfunks zu 2 Jahren und 7 Monaten Gefängnis verurteilt : Er hatte Sendeplätze gegen Geld für a) den Sender („Produkti-onskostenzuschüsse“) und b) für sich privat an zahlungskräftige und zahlungswillige Sportveranstalter verkauft.
Ein journalistisches Desaster für den hessischen Sender. Hinweise und Warnungen hatte es schon Jahre zuvor gegeben. Und wer sich Sportübertragungen im Hessischen Rundfunk (hr) ansah, konnte sehen, wie auffällig z.B. bestimmte Firmenlogos a) prominent im Bild und b) mit auffällig langer Standdauer gezeigt wurden.
2003 hatte die Frankfurter Ausgabe der BILD-Zeitung getitelt: „Sendeplätze nur gegen Geld“. Zwei Monate später war in der „Welt“ über den hr zu lesen: „Ohne Moos nix los“.
Auch als sich noch im selben Jahr ein Sportveranstalter beim Hessischen Ministerpräsidenten darüber beschwerte, dass er für die traditionelle Fernsehübertragung des „Ironman - Triathlon“ diesesmal 95.000 € Produktionskostenzuschuss leisten musste, geschah wenig. Der Brief wurde an den hr-Intendanten weitergeleitet. Der dann beauftragten hr-Innenrevison wiederum fiel nicht auf, dass von der fraglichen Summe ganze 30.000 € beim hr angekommen waren.
Dem Rundfunkrat, der sich nach eigener Einschätzung „ausführlich“ mit den Vorwürfen im Rahmen des Themas „Sponsoring von Sportsendungen des hr“ in Anwesenheit von Emig beschäftigte, fiel nichts weiter ein, als den Kritisierten bzw. Beschuldigten danach zu fragen, ob denn „die hr-Richtlinien für das Sponsoring, die zu den strengsten in der ARD zählen, stets exakt und in allen Punkten eingehalten worden seien“, was dieser bejahte.
Anfang März 2004 begann dann die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) mit einer regelmäßigen Berichterstattung über Merkwürdigkeiten beim hr, insbesondere in der Fernsehdirektion Sport und dessen Chef Jürgen Emig. Die HNA druckte immer mehr Belege und Rechnungen ab, die die Käuflichkeit journalistischer Leistungen beim hr eindeutig belegten. Drei Wochen später zog der hr-Sportchef dann selbst Konsequenzen (Die ganze Geschichte ist ausführlich dokumentiert unter Käuflichkeit journalistischer Arbeit: Der Fall Jürgen EMIG. Der Reporter der HNA hatte dafür 2004 einen "Wächterpreis der Tagespresse" zugesprochen bekommen).

Die geschilderten Fälle beim Hessischen Rundfunk sind klassische Beispiele für Fehlleistung und Funktionsversagen.
Die Negativliste lässt sich leicht verlängern:
- Schleichwerbungsskandal bei der Bavaria GmbH (WDR, BR, SWR, MDR),
- der analoge Emig-Fall „Mohren“ beim MDR,
- die Pleite der Telefilm Saar GmbH (SR),
- ZDF-Themenpark in Mainz,
- Ausladung des Putin-Kritikers Kasparov bei „Sabine Christiansen“ (ARD/NDR),
- heimliche Verträge mit dem Sportidol Jan Ullrich
Zum Thema Jan ULLRICH mehr bei ansTageslicht.de unter
Die Idee der Modellkonstruktionen "Rundfunkrat" und "Fernsehrat"
Im Prinzip liegen der Modellkonstruktion ‚Rundfunkrat’ allerdings sinnvolle Absichten und Ziele zugrunde. Darum geht es in diesem Abschnitt. In allen späteren soll der Frage nachgegangen werden, wie effektiv funktioniert die Kontrolle nach heutige Maßstäben und was heißt es, wenn diese Kontrolle nicht funktioniert oder funktionieren kann?
Überträgt man das demokratische Modell der Gewaltenteilung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (örRF), so ist der Rundfunkrat bei der ARD – analog der Fernsehrat beim ZDF – eine Art ‚Legislative’ zumindest in jener Hinsicht, als dass dieses Gremium die Exekutive, sprich den Intendanten, sowie das gesamte inhaltliche Geschehen in einem öffentlich-rechtlichen Sender beaufsichtigen, sprich kontrollieren soll. Das Aufgabenspektrum liest sich ersteinmal verantwortungsvoll, auch wenn es im Detail in den vielen einzelnen Rundfunkstaatsverträgen abweicht – Rundfunk ist wie Kultur und Medien Ländersache: So hat dieses Gremium ganz allgemein gesprochen die Aufgabe, die Interessen der Allgemeinheit (u.a. Gebührenzahler) gegenüber den Eigeninteressen einer Rundfunkanstalt geltend zu machen.
Doch große Institutionen beginnen bekanntlich schnell ein Eigenleben zu führen, wenn es keine klaren Vorgaben und/oder Grenzen gibt.
Konkret hat der Rundfunkrat (synonym für Fernsehrat beim ZDF) a) die Programmleitlinien vorzugeben und b) deren Einhaltung zu überwachen. Da das Gremium Aufsichtsfunktion hat, obliegt es diesem Gremium logischerweise, den an der Spitze der Exekutive (Rundfunkanstalt) agierenden Intendanten zu wählen und ihn gegebene-falls auch wieder abzuwählen, wenn der seinen Aufgaben nicht nachkommt.
Die Überwachungskompetenz bezieht sich allerdings nicht auf konkrete inhaltliche Vorgaben vorab, sondern ist auf die nachträgliche Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkt. Nur im Fall einer so genannten Programmrüge bei bereits gesendeten Beiträgen können die Mitglieder eine mögliche Wiederholung verhindern. Da die aus weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kommen (sollen), um die Mei-nungsvielfalt in der Bevölkerung zu repräsentieren, wollte man mit dieser Konstruktion und diesen Kontrollfunktionen den Binnenpluralismus innerhalb des Programms garantieren. „Staatsferne“ ist ange-sagt.
So aufrichtig diese Idee aus der unmittelbaren Nachkriegszeit bis heute überliefert ist, so blaß zeigt sie sich in der heutigen Praxis. Demokratische Mitbestimmung musste man damals erst buchstabieren lernen und „Transparenz“ zählte nicht zu den vorrangigen Sorgen zu Zeiten des bundesdeutschen Wiederaufbaus. Man war mit dem Lecken von Wunden einer gemeinsamen Vergangenheit beschäftigt, über die man – eigentlich – nicht mehr sprechen wollte.
Eintracht war dabei angesagt, nicht eine Diskussion über heute selbstverständliche Managementmethoden wie Soll-Ist-Vergleiche, Controlling von Ziel- und Leistungsvorgaben oder gar Kritikkultur. Problemfelder wie Interessens- und Zielkonflikte gerieten ohnehin erst später erst in die fachliche, dann in die öffentliche Wahrnehmung. So stehen mehrere Konstruktionsschwächen und Konstruktionsfehler im Visier der nachfolgenden Überlegungen, konkret folgende Aspekte auf der Agenda:
- institutionelle Kongruenz zwischen Exekutive und Kontrollorgan (bei der ARD);
- Öffentlichkeit und Transparenz der Kontrollarbeit; Controllingbereiche und Beaufsichtigungspraktiken;
- Repräsentanz der Kontrollgremiums
- sowie die Frage, ob sich diese Gremien angesichts eigentlich größerer Funktionen und Aufgaben nicht mehr ‚professionalisieren’ müssten, um ihren Job wirklich erledigen zu können.
Institutionelle (In)Kongruenz zwischen Exekutive und Kontrollinstanz
Dieser Textabschnitt ist kleiner gesetzt, weil es hier um eher grundsätzliche Überlegungen geht, die vielleicht nicht für jeden Leser interessant genug sind. Den darauffolgenden Abschnitt kann man dann wieder in der gewohnten Schriftgröße lesen.
Der Unterschied zwischen Rundfunkrat und Fernsehrat bezieht sich nicht nur auf die sprachliche Begrifflichkeit und darauf, dass der Fernsehrat des ZDF mit über 70 Vertretern mehr als doppelt so groß ist wie ein durchschnittlich besetztes Gremium von 30 Mitgliedern einer ARD-zugehörigen Rundfunkanstalt. Der eigentliche Gegensatz besteht darin, dass das programmliche Geschehen des ZDF von ‚seinem’ Fernsehrat begleitet und kontrolliert wird, der für das gesamte ZDF-Programm zuständig ist.
Das ARD-Programm wird von allen Zuschauern ebenfalls als ein (einheitliches) Programm („Das Erste“) wahrgenommen, aber es gibt keinen Rundfunkrat auf ARD-Ebene, der sozusagen auf gleicher organisatorischer, inhaltlicher und/oder zuständigkeitskompetenter Ebene dieses Programm beaufsichtigen könnte: die insgesamt 9 Rundfunkratsgremien der zur „Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“ zugehörigen Sender (WDR, NDR, SWR, BR, HR, RBB, MDR, SR, RB) sind jeweils eigenständige Institutionen wie die Anstalten ebenfalls. Niemand hat – im Gegensatz zum ZDF – direkten Zugriff auf das gesamte „Erste“ Fernsehprogramm. Die einzelnen Rundfunkanstalten liefern dem gemeinsamen ARD-Programm nur zu. Folglich beziehen sich alle weiteren Überlegungen dieses Kapitelabschnitts auch nur auf diesen Senderverbund.
Der ARD liegt eine föderale Grundstruktur zugrunde, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit sowie Berücksichtigung des Regionalen sichern soll. Aus den vielfältigen Theorien des (fiscal, cultural) federalism wissen wir, dass dies mit mehreren dezentralen Institutionen und Regelungen besser gelingt als mit einem großen einheitlichen und dann eher zentralisierten Apparat. Zwar erhöhen sich im ersten Fall dadurch die Kosten, z.B. durch Doppelungen etc, und machen auch eine gemeinsmane Konsensfindung aufwendiger als in der zweiten Alternative, aber dies sind zwangsläufig unumgängliche (Mehr)Aufwendungen, wenn man dezentrale Vielfalt möchte. Diese dezentrale Lösung im „Ersten“ ist daher eine interessante Alternative zum „Zweiten“, die ebenfalls und potenziell zusätzliche Vielfalt zwischen beiden Programmen generieren kann.
Dem gemeinsamen „Ersten“ liefern die einzelnen Sender in unterschiedlichem Umfang zu und nur weniges ist als ‚gemeinsame’ Produktion zentralisiert (ARD Aktuell beim NDR). Im Durchschnitt verwenden die 9 Rundfunkanstalten (RFA) etwa 20% ihres (sehr unterschiedlichen) Etats für das ARD-Gemeinschaftsprogramm. Diskrepanzen zwischen Zulieferung und individuellem Gebührenaufkommen versucht man im Wege eines Finanzausgleichs zu glätten.
Um das gemeinsame „Erste“ über ein Minimum an institutionellen Regularien nachhaltiger und auch planbarer zu gestalten, wurden im Lauf der Jahre mehrere Funktionen auf einer oberen ARD-Ebene zentralisiert, aber in sehr unterschiedlichen Maße. Dies betrifft auch nur einzelne Aufgaben. Die rechtliche Verantwortlichkeit findet immer nur auf dezentaler Ebene statt. Die ARD ist selbst nicht rechtsfähig. Hier lässt sich eine erste Inkongruenz ausmachen, was bedeutet, dass es zwischen praktizierter Lösung und zurechenbarer Verantwortlichkeit Diskrepanzen gibt. Inkongruenzen repräsentieren in den seltesten Fällen optimale Lösungen.
An der Spitze dieser so gestrickten ARD agiert (nicht: steht) der ARD-Vorsitzende, der eine Art Sprecher- und Geschäftsführerfunktion innehat, die innerhalb der 9 Sender rotiert. Um das „Erste“ auch nach außen hin als Einheit hinsichtlich Programm und Repräsentanz (z.B. offizielle Sprachregelungen) erscheinen zu lassen, agiert der „Vorsitzende“ in der Intendantenrunde mal als „Moderator“, mal als „Dompteur“. Es ist eine eher informelle Verantwortungsfunktion. Fest zentralisiert hingegen und dort auch mit entsprechenden Verantwortungsompetenzen ausgestattet, also intern kongruent gelöst, ist die Institution des ARD-Programmdirektors. Dieser übt eine vergleichsweise große Machtfülle aus.
Um nun die Idee der Kontrolle auf das Gemeinschaftsprogramm zu übertragen, finden sich die Vorsitzenden aller 9 Rundfunkratsgremi-en in einer gemeinsamen Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) wieder. Der Vorsitzende wiederum dieser zentralisierten GVK wird nicht vom GVK-Gremium selbst gewählt, sondern rotiert parallel zu jener Sendeanstalt, deren Intendant gerade als ARD-Vorsitzender agiert. Abhängig vom mehrheitlichen Selbstverständnis einzelner Rundfunkratsgremien und deren Vorsitzenden wird begreiflicher-weise Kritik laut, ein GVK-Vorsitzender laufe schnell Gefahr, „Statt-halter“ des jeweiligen Intendanten“ und „seiner Anstalt“ zu werden.
Die offizielle Funktion dieser GVK besteht darin, Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zur Vorbereitung der ARD-Hauptversammlung vorzubereiten. Konkret bedeutete das bisher: die GVK hatte keinerlei Entscheidungs- oder Handlungskompetenzen.
Erst seit kurzem versucht man nun (§ 5a ARD-Satzung), diesem Gremium eigenständige (Mini)Funktionen zukommen zu lassen: konkret spezielle Koordinierungsbefugnisse bei der Beratung der Haushalts- und Finanzplanung sowie Rechnungslegung der so ge-nannten GSEA, Gemeinschafts-Sendungen, -Einrichtungen und –Aufgaben der ARD) sowie den gemeinschaftlichen Beteiligungsun-ternehmen (z.B. Degeto). Wenn es um die Besetzung hoher ARD-Positionen im Direktorenrang geht (Programmdirektor) ist mit ihr „Benehmen“, nicht „Einvernehmen“ herzustellen. Letzteres ist in-soweit wieder systemkonform als auch die regionalen „Direktoren“ in einzelnen Fällen vom Rundfunkrat gewählt oder abgewählt werden (können).
Letztlich handelt es sich bei dieser ‚nach oben’ transportierten Kon-trolllösung vor allem deshalb um eine absolut zahnlose Tigerlösung, weil bereits auf der Ebene der ARD-Exekutive keine in sich ge-schlossene Dachlösung beispielsweise in Gestalt eines ARD-Intendanten besteht. Es gibt auch keine ARD-weite Produktplanung namens „Gemeinschaftsprogramm“ hinsichtlich Nutzen und Kosten, also etwa hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben, schon garnicht in Gestalt einer zukunftsorientierten mittelfristigen Planung.
In anderen föderal strukturierten Systemen (z.B. Kommunen – Bundesländer – Bund) existiert ein abgestuft dezentrales und gleichzeitig zentralisiertes Pyramidensystem an Zuständigkeiten und verantwortli-cher Kompetenz, so dass jede Ebene, egal ob unten oder oben, durch die Kongruenz beider Entscheidungs- und Handlungsbereiche ausrei-chend optimal funktionieren kann.
Bei der ARD entscheiden im Ergebnis über zentrale Fragen des Pro-gramms und dessen Finanzierung a) 9 regionale Intendanten sowie b) der nach oben hin ‚entrückte’ ARD-Programmdirektor. Das zum regionalen Runfunkrat analoge Kontrollorgan GVK hat zum einen we-er Informationen über Planungs- und Finanzdaten mit Zukunftswirkung, die es kontrollieren könnte, weil es die gar nicht gibt. Zum anderen fehlt dem Gremium ein analoger, direkter ‚Ansprechpartner’. Dieses Kontrollvakuum lässt daher eine „unkontrollierte Machtfülle der Exekutive auf ARD-Ebene“ entstehen, die „europaweit wohl einmalig sein dürfte“.
Das wäre noch nicht einmal der entscheidende Schwachpunkt. Problematischer scheint der Umstand, inwieweit eine solch abgehoben handeln könnende Ebene für Zukunftsprobleme gerüstet ist, wenn auf der anderen Seite eine schlagfähige, weil durchgehend kongruent organisierte Konkurrenz namens ZDF agiert, deren Entscheidungen durch das gegenseitige Wechselspiel von Diskussionen und präventiver Beaufsichtigung im Fernsehrat breits vor-optimiert sind.
Beispiel: die politischen Magazine
Das ZDF-Format „Frontal21“ hat seit Jahren a) einen festen und b) prominenten Sendeplatz sowie eine Sendedauer von c) 45 Minuten und dies d) jede Woche. Es ist damit nicht nur in der Programmschiene, sondern vor allem in der Wahrnehmung der Zuschauer fest verortet. Der ZDF-Fernsehrat signalisiert bereits seit längerer Zeit, dass er einer Reduzierung des Informationsanteils zugunsten mehr Unterhaltungsformaten nicht zustimmen würde.
Die TV-Magazine der ARD (Panorama, Monitor etc.) hingegen wechseln in mehr oder weniger alle Jahre ihre Sendeplätze, weil sie schon lange zum Spielball bzw. zur Knautschmasse der 9 ARD-Intendanten und deren Programmplaner geworden sind. Derzeit sind es insgesamt 6 Formate, die teils montags, teils donnerstags alternierend im Drei-Wochenabstand ausgestrahlt werden. Der Zuschauer nimmt dies zwar als festen Sendeplatz wahr, weiß aber in der Regel nicht, welches der für diesen Sendetag vorgesehenen Magazine auf Sendung gehen wird. Im Zusammenhang mit dem Vorhaben, die Tagesthemen von ehemals 22:30 auf 22:15 Uhr vorzuziehen wurden die Magazine sogar um ein ganzes Drittel ihrer Sendezeit auf nur noch 30 Minuten zusammengestutzt. Jetzt gibt es sogar Diskussionen, aus 6 Magazinen nur noch 4 zu machen, die dann regelmäßig alternierend 1 Mal pro Monat ausgestrahlt werden könnten.
Bei der ARD spielen sich die Mitwirkungsmöglichkeiten und Kon-trollrechte ausschließlich auf dezentraler Ebene, den regionalen Rundfunkräten ab. Das gemeinsame Programm ist ‚entrückt’.
Dass auf der oberen Ebene eine weitere institutionalisierte Einrich-tung namens Programmbeirat existiert, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Dessen 9 Mitglieder rekrutieren sich aus den 9 Rund-funkratsgremien. Der „Programmbeirat“ heißt nicht „Programmauf-sichtsrat“ und hat (deshalb nur) beratende Funktion gegenüber dem ARD-Programmdirektor, kurz gesagt: keine wirkliche Aufgabe.
Zusammengefasst: Inwieweit die ARD hinsichtlich Programmleistung und dessen Finanzierung
- angesichts rückläufiger Bevölkerungszahlen und nicht mehr automatisch sprudelnder Gebührenaufkommenszuwächse sowie
- im Hinblick auf die digitale Herausforderung im Internet
- und der damit einhergehenden Frage nach der Akzeptanz der nachwachsenden Entscheidergeneration
in ihrem organisatorischen Korsett zukunftsfähig sein wird, wird sie selbst definieren (müssen).
Transparenz und Öffentlichkeit
Man mag es nicht glauben, aber es ist so und dies bereits schon immer: die meisten Rundfunkratsgremien, die die Interessen der Allgemeinheit vertreten (sollen), tagen in geübter und tradierter closed-shop-Manier hinter verschlossenen Türen. Konkret: nicht öffentlich.
Dass dies den rund 500 Vertretern selbst noch nicht aufgefallen ist oder dass sie zumindest dieses elementare Prinzip nach außen hin nie als Problem thematisiert haben, spricht für das mehrheitliche Selbstverständnis dieser Gremien. Auf letzteres gehen wir im Abschnitt „Vertreter“ ein. Hier geht es um das Thema Öffentlichkeit. Man kann den Umstand der Nicht-Öffentlichkeit offen als öffentlich-rechtlichen Anachronismus bezeichnen.
Spricht man über „Öffentlichkeit“ und „Transparenz“ im „öffentlich-rechtlichen“ Rundfunkwesen, so sind zwei Ebenen damit angesprochen. Zum einen die interne Ebene. Sie bezieht sich auf den Informations- und Kommunikationsfluss zwischen den Kontrollgremien und den von diesen zu kontrollierenden Aufgaben und Bereiche. Die andere Ebene bezieht auf den Runfunkrat und die Kommunikation nach außen: zu jenen, die diese Gremien vertreten (sollen) bzw. zu jenen, die letztlich alles finanzieren.
Zunächst zur internen Transparenz. Dass sich z.B. ein ARD-gemeinsames Beteiligungsunternehmen – in diesem Fall die Produktionsfirma Bavaria München – weigern konnte, einem Rundfunkratsgremium sowie einem parlamentarischen Ausschuss eines Landtags – in diesem Fall des Rundfunkrats des MDR, der an der Bavaria selbst beteiligt ist, bzw. dem Medienausschuss des Sächsischen Landtags – Auskunft bzw. Berichte zu übergeben, die die Bavaria über ihr eigenes Problem Schleichwerbung erstellt hatte, repräsentiert ein typisches Beispiel für den öffentlich-rechtlichen Anachronismus bzw. für das Selbstverständnis des öffentlich-rechtlichen Sektors.
Weil dem so ist und auch intern weitgehend nach dieser Closed-Shop-Methode gearbeitet wird, hat es auch entsprechend lange gedauert, bis die nicht nur fragwürdigen, sondern schlicht und ergreifend illegalen Methoden von Schleichwerbungspraktiken bei der Bavaria bekannt geworden sind. Es waren nämlich nicht interne Transparenz- und/oder -Controllingmechanismen, die zur Abstellung bzw. zur Aufdeckung dieser eklatanten Missstände führten, sondern externe ‚Kontrolleure’. Im konkreten Fall war es ein Medienjournalist, der im Rahmen seiner journalistischen Watch-Dog-Funktion einschlägigen Hinweisen nachgegangen war. Bis zur Veröffentlichung seiner Recherchen hatte es allerdings zweieinhalb Jahre gedauert, weil die ertappten Akteure ersteinmal gerichtliche Gegenmaßnahmen durchsetzen konnten.
Der Fall Bavaria und die Serie "Marienhof" - eine kleine Rückblende:
Konkret hatte der epd-medien-Redaktionsleiter Volker Lilienthal nach ersten Hinweisen im Sommer 2002 auf Schleichwerbungspraktiken in der ARD-Sendung „Marienhof“, produziert von der ARD-eigenen Bavaria, Recherchen angestellt, die für die Verifikation auch eine verdeckte Recherche notwendig machten. Im Nachgang hierzu klagte eine bei diesen Praktiken eingeschaltete Placement-Agentur auf Unterlassung, was einem faktischen Recherchier- und Publikationsverbot für den Journalisten gleichkam. Lilienthal nutze die darauf folgenden 1 ½ Jahre, indem er die Sendungen zusätzlich systematisch auf entsprechende Praktiken hin auszuwerten begann. Erst ein Urteil des OLG München Anfang 2005 führte zur Aufhebung der Unterlassungsklage, woraufhin Lilienthal seine Geschichte ans Tageslicht bringen konnte. Sie löste im öffentlich-rechtlichen Sektor ein mittleres Erdbeben aus.
LILIENTHAL hat inzwischen die Rudolf-AUGSTEIN-Stiftungsprofessur "Qualitätsjournalismus" an der Uni Hamburg inne.
In Fall "Marienhof" waren es die Aufsichtsgremien gleich von vier Rundfunkanstalten, die in einer ihrer wesentlichsten Funktionen vollständig versagt hatten.
Detailfragen zu gängigen Usancen solch öffentlich-rechtlicher Verschleierung bzw. zu der damit verbundenen Problematik werden wir im nächsten Kapitelabschnitt „Controlling“ vorstellen. Hier soll es zunächst um die prinzipiellen Fragen gehen.
Die beziehen sich vor allem auf die Kommunikationsfähigkeit nach außen hin. Es geht also vor allem um die Außentransparenz. Und dies betrifft vor allem das Selbstverständnis dessen, was man unter „öffentlich“ bzw. „öffentlich-rechtlich“ versteht.
Es gibt einige Ausnahmen. Radio Berlin-Brandenburg (RBB) tagt z.B. im Prinzip öffentlich. Wirklich „öffentlich“ wird aber immer nur das, was auch tatsächlich kommuniziert und/oder beworben wird. Wer nicht weiß, dass es einen Rundfunkrat gibt, wem nicht bekannt ist, was dessen Funktion ist und wer dann auch nicht mitgeteilt bekommt, dass dieser öffentlich tagt und was denn auf der Tagesordnung steht und welche Bedeutung dies für jeden Einzelnen hat, für den ist eine solche Öffentlichkeit letzten Endes nicht öffentlich.
Egal wie: Lässt man die mühsame Entwicklung der gesellschaftlichen Partizipation bzw. die historische Genese der Mitsprache von Menschen an all den Dingen Revue passieren, die von eben diesen Menschen getragen, z.B. finanziert werden und die nicht nur deshalb direkte Rückwirkung auf deren Befindlichkeit haben, so scheint es einigermaßen unverständlich, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts Transparenz im so genannten öffentlich-rechtlichen Sektor nicht selbstverständlich ist. Vergleicht man die wachsende Partizipation von Bürgern in immer mehr Bereichen, die immer auch mit zunehmender Transparenz einhergehen (öffentliche Haushalte und so genannte Neben- bzw. Schattenhaushalte, Sozialversicherungswesen, Spendenbranche u.a.m.), so verkörpert der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Relikt aus ‚überholten’ Zeiten.
Es gibt Vorschläge. Im Rahmen einer fachöffentlichen Debatte, die politisch durch EU-Vorgaben aus Brüssel initiiert und von dem Branchendienst „epd medien“ 2007 aufgegriffen und publiziert wurden, haben sich viele der dort zu Wort gekommenen Experten mit sehr konkreten Ideen hervorgetan.
Dass ein Rundfunkratsgremium per se nach Transparenz und Öffentlichkeit verlangt, war durchgehend Konsens. Darüberhinaus reichen die Vorschläge von in allen Bundesländern einheitlichen Regularien etwa bei Programmbeschwerden (analog zur Freiwilligen Selbstkontrolle bei den Printmedien durch die Institution des Deutschen Presserats) über Fragerechte der Gremienmitglieder (analog zum Fragerecht von Abgeordneten in Parlamenten) bis hin zu Überlegungen, analog zu anderen Bereichen dem Ver-tretergremium das eigenständige Recht einzuräumen, unabhängige Tätigkeitsberichte herausgeben zu dürfen.
Da im Zusammenhang mit der Neuordnung des Dualen Systems im Internet die EU medienpolitische Vorgaben gemacht hat, die in absehbarer Zeit umgesetzt werden müssen, ist die Chance groß, dass sich hier einiges zum Besseren, sprich zum Selbstverständlichen wenden wird. Auffällig aber auch hier: Die Veränderungen gehen nicht vom öffentlich-rechtlichen System aus. Auch nicht von jenen, die kraft ihrer Funktion dafür eigentlich berufen wären.
Ganz offensichtlich muss man den Öffentlich-Rechtlichen Nachhilfe geben: Transparenz hat etwas mit Kommunikationswilligkeit und Kommunikationsfähigkeit zu tun. Kommunikation wiederum hat – zumal mit den eigenen ‚Kunden’ – Einfluß auf die Akzeptanz. Die wiederum wird langfristig über die Nachhaltigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems entscheiden.
Controlling: Kontrolleure ohne Kontrolloptionen?
Controlling ist zunächst das reine Konstatieren oder Messen von Abweichungen zwischen „Soll“ und „Ist“. Also ein Check, ob das, was man sich vorgenommen hat, erreicht wird bzw. in welchem Umfang. Man kann das in Graden der Effektivität messen: zu wieviel Prozent hat man ein Ziel erreicht oder eine Aufgabe erfüllt – einhundertprozentig oder nur zu 80%? Man kann es aber auch in Ergebnis-Kosten-Relationen (Kosten-Nutzen-Analyse) machen: mit welchem Aufwand wurde das Ziel (teilweise oder ganz) erreicht? In diesem Fall misst man die Effzienz. Quantitative Größen lassen sich dabei bekanntermaßen einfacher bewerten als qualitative. Dies betrifft meist interne Standards und Zielvorgaben.
Kundenreklamationen von außen und Qualitätssicherung im Allge-meinen, also die Wahrnehmung und Akzeptanz eines Unternehmens sowie dessen Produktpalette und Service, sind ebenfalls typische Felder regelmäßiger Überprüfung zum Zwecke einer permanenten Optimierung.
Das Controlling einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ist gesetzlich festgelegt. Da der ör Rundfunk hierzulande „staatsfern“ sein muss, obliegt die inhaltliche Kontrolle bzw. die Fürsorge hinsichtlich ausreichendem Binnenpluralismus bei der Meinungsvielfalt der Sendungen dem Rundfunkrat, wie bereits skizziert. Diese Beauftragung ist in der Regel vage beschrieben.
Im Gesetz für den Hessischen Rundfunk heißt es, das Gremium „vertritt die Allgemeinheit auf dem Gebiete des Rundfunks“ (§ 5 hr-Gesetz). Bei Radio Berlin Brandenburg (RBB): „Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung der Programmgrundsätze und berät den Intendanten oder die Intendantin in allgemeinen Programmangelegenheiten“ (§ 13 RBB-Gesetz). Das WDR-Gesetz interpretiert die Aufgabe bereits etwas konkreter: „Der Rundfunkrat vertritt im WDR die Interessen der Allgemeinheit; dabei berücksichtigt er die Vielfalt der Meinungen der Bürgerinnen und Bürger. Er stellt im Zusammenwirken mit den anderen Anstaltsorganen sicher, dass der WDR seine Aufgaben im Rahmen der Gesetze erfüllt.“ Und weiter: „Der Rundfunkrat berät und beschließt über alle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Anstalt“ (§ 16 I u. II WDR-Gesetz).
Dazu gesellen sich dann weitere Aufgaben, die im Einzelfall bis hin zur Besetzung von Direktorenposten gehen können u.a.m.
Für die Kontrolle der geschäftlichen Obliegenheiten, sprich finanziellen, organisatorischen und sonstigen verwaltungsmäßigen Angelegenheiten gibt es ein zweites Gremium, dessen Mitglieder u.a. vom Rundfunkrat gewählt werden: der Verwaltungsrat. In diesen ist vor allem die Zuständigkeit für alles Finanzielle ausgelagert sowie ganz allgemein die „Überwachung der Geschäftsführung“ seitens der Intendanz. Der Intendant wird übrigens auch vom Verwaltungsrat vorgeschlagen, gewählt aber dann vom Rundfunkrat (bzw. ggfs. auch wieder abgewählt). Es existiert also eine abgestufte Arbeitsteilung, Von der Repräsentationsverpflichtung der Allgemeinheit her gesehen ist der Runfunkrat demnach das bedeutendere Gremium.
Diese Arbeitsteilung bedeutet eine Zweiteilung der Kontrolle und erschwert eine ganzheitliche Betrachtung hinsichtlich Output und Input, sprich Ergebnis und Kostenaufwand. Eine programmbezogene oder spartenbezogene Produkt- und Kostenkontrolle ist damit unmöglich. Und je nachdem, wie eng oder auch nicht beide Gremien oder einzelne Mitglieder kommunizieren und/oder kooperieren, arbeiten im schlechtesten Fall beide Gremien voneinander unabhängig bzw. aneinander vorbei. Die letztere Variante dürfte die Regel sein.
Während ein „Aufsichtsrat“ im privatwirtschaftlichen Bereich Beaufsichtigungsrechte hat, die im Prinzip alles umfassen und im Zweifel auch den Zugriff auf „Bücher und Schriften“ für die Kontrolle ermöglichen, ist beim ör Rundfunk für wirtschaftliche Fragen der Verwaltungsrat zuständig, aber nicht für das Inhaltliche. Beim Rundfunkrat ist es genau andersherum.
Ob ein Verwaltungsratsgremium tatsächlich „die Bücher, Rechnungen und Schriften des WDR einsehen und prüfen, Anlagen besichtigen und Vorgänge untersuchen“ kann, hängt von den individuellen gesetzlichen Vorgaben ab. Der Rundfunkrat kann das per se nicht. Ansonsten obliegt ihm nur die „Feststellung“ (z.B. WDR, RBB) bzw. „Genehmigung“ (z.B. hr) des Haushaltsplans etc. Beim WDR darf der Rundfunkrat z.B. auch nicht die Prüfberichte des Landesrechnungshofs im Original einsehen, sondern allenfalls die schriftliche Stellungnahme seitens der Intendanz dazu.
Was auf der Ebene einer Rundfunkanstalt bereits unmöglich erscheint, wird noch unwahrscheinlicher, wenn es um – aus welchen Gründen auch immer – ausgelagerte Aktivitäten geht, die sich dann bei rein formaljuristischer Betrachtungsweise der gesetzlichen Kontrolle vollständig entziehen (können). Vergessen wird dabei regelmäßig, dass unsere Rechtsordnung vorrangig dispositives Recht darstellt und dass man grundsätzlich fast immer alles ganz anders machen kann. Vorausgesetzt, man möchte es.
Diese einfache Überlegung trifft im Prinzip bereits den Kern des Problems, wenn es um Aktivitäten in Beteiligungsunternehmen und/oder so genannten Schattenhaushalten geht. Ob beispielsweise ein Aufsichtsrat eines ausgelagerten Rundfunk-Tochterunternehmens (z.B. GmbH) sowohl mit Vertretern der Exekutive (Intendanz) als auch mit solchen aus dem Rundfunkrat bestückt ist oder ob die die Kontrolle seitens des Rundfunkrats ganz oben ansetzt, weil der Aufsichtsrat der Tochter nur durch Exekutivrepräsentanten besetzt ist, macht dann keinen Unterschied, wenn unabhängig von der gewählten Konstruktion das vorgegebene Ziel klar ist, dass Kontrolle ausdrücklich erwünscht ist und dies auch tatsächlich realisiert wird.
Z.B. durch entsprechenen Informations- und Kommunikationsfluß zwischen unten und oben, ausreichende Transparenz aller Spielregeln im vorhinein und durch die Möglichkeit gezielter Nachfragen zu allem seitens der Kontrolleure.
Im Fall der verweigerten Auskünfte seitens des Gemeinschaftsunternehmens Bavaria an den MDR-Rundfunkrat, was deren eigenen Ermittlungserkenntnisse hinsichtlich seines Schleichwerbungsskandals („Marienhof“, siehe vorigen Kapitelabschnitt) betraf, war es der Bavaria-Aufsichtsrat, der mehrheitlich entschieden hatte, diese Auskünfte nicht nach oben, sprich an die Rundfunkratskontrolleure des MDR zu geben. Dem Bavaria Gremium gehörten allerdings nicht nur die 4 Eigentümer-Intendanten an (WDR, BR, SWR, MDR), sondern auch diverse Verwaltungs- und Fernsehdirektoren dieser Sender. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria fungierte sinnigerweise ein Rundfunkratsvorsitzender: jener des WDR, Reinhard Grätz. Dieses Beispiel könnte nicht besser die sich hier überlagernde Verflechtung zwischen Kontrolleuren und zu Kontrollierenden demonstrieren. Systemimmanente Interessenskonflikte bringen selten adäquate Lösungen zutage:
Ist Kontrolle und Optimierung, sprich Weiterentwicklung durch Kontrolle erwünscht, dann muss man dies auch adäquat organisieren. Solange Kontrolleure und zu Kontrollierende eine zu enge räumliche und/oder inhaltlich-mentale Nähe und zu wenig kritische Distanz praktizieren, läuft Controlling in die Leere.
Controlling setzt aber auch ein Mindestmaß an Kritikkultur, insbesondere auf Seiten der zu Kontrollierenden voraus. Bekanntermaßen ist Streitkultur und inhaltliche Auseinandersetzung unbequemer und zeitaufwendiger als einträchtige (vorgetäuschte) Harmonie. Wer aber nicht bereit ist, andere Positionen an sich heranzulassen, auf Argumente einzugehen oder auch mal eigene Positionen in Frage zu stellen und zu überdenken, wem statt dessen die öffentlich-rechtliche Ignoranz-Mentalität bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist, und wer sich es dann auch schon aus arbeitsrechtlichen Gründen leisten kann (quasi unkündbarer Status), alles an sich abprallen zu lassen, mit dem wird man zwar mal ‚sprechen’ können, eine zielführende Auseinandersetzung ist aber nicht möglich. Dies entspräche dem Minimalfall, dass man Kritik oder Beschwerden einfach nur ‚los wird’ – aus Gründen der Höflichkeit, aber nicht ernst gemeinter Hoffnung auf Optimierung.
Wer hingegen Weiterentwicklung will, im Wettbewerb um die treffenderen Argumente, der muss vor allem ein Mindestmaß an Streitkultur akzeptieren.
Institutionelle Kontrollmechanismen sind das eine. Eine weitere Voraussetzung betrifft das Selbstverständnis der eigenen Rolle. Das (mehrheitliche) Selbstverständnis eines jeden Rundfunkratsgremiums ergibt sich letztlich immer nur aus der Summe all jener, die ihre eigene Rolle und Selbsteinschätzung im Zweifel bereits schon dort praktizieren, wo sie als Funktionäre und/oder Spitzenvertreter jene Gruppen oder Verbände repräsentieren, die sie im Wege der gesetzlichen Repräsentanz eben auch im Rundfunkrat vertreten. Je etablierter und traditierter aber ihre originäre Rolle bereits in dem von ihnen repräsentierenden Bereich (Partei, Kirche, Gewerkschaft, Arbeitgeberverband etc) ausfällt, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet von diesen Vertretern Diskussionen um neue unkonventionelle Ideen oder gar neue Wege im Rundfunkratsgremium initiiert werden.
Unterm Strich lässt sich klar resümieren: Eine Kontrolle gibt es nur auf dem Papier. Eine klare Zukunftoption ist das nicht.
Vertretung und Repräsentanz
An den – eigentlich misslichen – Umstand, dass sich in parlamentarischen Gremien die Zusammensetzung der Bevölkerung praktisch nie widerspiegelt, hat man sich schon lange gewöhnt. Man argumentiert mit (intellektueller) Arbeitsteilung und/oder dem Umstand, dass sich eine zeitlich – fürs politische Engagement – begrenzte ‚Auszeit’ aus dem beruflichen Weg ‚nach vorne’ oder ‚nach oben’ nicht jeder leisten kann oder will. Die Folgen: stete Zunahme des Berufspolitikertums sowie permanente Professionalisierung mit der Anschlussfolge, dass zwischen Gewählten und Wählern eine immer größere fachliche und vor allem mentale Diskrepanz entsteht. Politiker verstehen sich oft als eigene Kaste, ohne sich noch klarzumachen, dass sie – eigentlich – ein nur auf Zeit vergebenes Mandat vertreten.
In den Rundfunkratsgremien ist dies nicht anders.
Dies geht schon damit los, dass in vielen dieser Gremien die Politik in unterschiedlichen Anteilen qua Eigenvertretung präsent ist. Im Fernsehrat des ZDF ist dies mit dem stärksten Gewicht der Fall: von 77 Mitgliedern entstammen 31 dem politischen (Berufs)Gewerbe. Dies entspricht 40%. Im WDR z.B. sind es 12 von 42 Mitgliedern bzw. knapp 30%. Über so genannte Freundeskreise, in denen sich parteinahe Sympathisanten auch aus anderen gesellschaftlichen Gruppen informell und jeweils zweckgebunden ‚organisieren’, verstärkt sich der politische Einfluß.
So wie der politische Einfluss gesetzlich geregelt ist, ist auf die selbe Weise auch der Zugang der anderen Gruppen genauestens reglementiert: „Wer reinkommt, ist drin“. Wer nicht, bleibt draußen. In einigen Fällen dürfen die auserwählten gesellschaftlichen Gruppen ihre Vertreter selbst benennen, in anderen müssen sie sich mit der endgültigen Auswahl aus 3 Vorschlägen durch die Ministerpräsidenten bescheiden (z.B. Fall ZDF).
Zu der ursprünglichen Idee und originären Konzepts der „Staatsferne“ im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passt dies nicht unbedingt. „Wenn man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk will, so wird dieser nur als staatsferner, aber stark in der Gesellschaft verankerter und gesamtgesellschaftlich anerkannter institutioneller Bereich langfristig eine Chance haben“, so die Quintessenz von Otfried Jarren im Rahmen der von epd medien angestoßenen „Gremiendebatte“.

Das angesprochene Problem ist schnell skizziert. Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch permanent zunehmende Ausdifferenzierungsprozesse aus, soziale Fragmentierung und mediale Individualisierung laufen dazu parallel einher. Ein Abbild dieser vielfältigen Trends, die sich durch Stichworte wie Menschen mit Migrantenhintergrund, Neue Soziale Bewegungen und NGO’s, Bürgerinitiativen und Watch-Dog-Organisationen, Selbsthilfegruppen und verbraucherorientierte Selbstorganisationen beschreiben lassen, stehen in deutlichem Kontrast zu den tradiert einflussreichen etablierten und hierarchisch verfassten Großorganisationen, egal ob es um Gewerkschaften, industrie- oder wirtschaftsnahe Verbände (z.B. Bauernverband) oder sonstige Interessensgruppen geht. Die letzteren sind drin, die erste Gruppe bleibt außen vor. Dies betrifft anerkannte Initiativen und NGO's wie Greenpeace, amnesty international, Transparency, LobbyWatch, B.U.N.D., u.a.m.
Die Unterschiede in der Repräsentanz liegen nicht nur in dem Gegensatz klein versus groß oder etabliert versus non-etabliert. Sie liegen auch in den grundsätzlichen Zielen und Konzepten begründet. Die traditionellen Verbände vertreten in der Regel spezifische, sprich egoistische Gruppeninteressen. Non-Governmental Organisationen z.B. haben weniger individualistische Eigeninteressen im Sinn als Interessen, die eine größere Gemeinschaft betreffen, oftmals sogar die gesamte Solidargemeinschaft.

Aus der Theorie (und Praxis) der Neuen Politischen Ökonomie ist bekannt, dass sich Präferenzen und Interessen auf Seiten der unzähligen anonymen Nachfrager und Betroffenen weit weniger effektiv ‚organisieren’ lassen als jene von Anbietern und Produzenten, die schon von der (numerischen) Anzahl her überschaubarer sind. Diese Asymmetrie der Organisierbarkeit spiegelt sich regelmäßig in unterschiedlicher Schlagkräftigkeit und darüber auch in der öffentlichen Wahrnehmung wider. In der Nachkriegsära, also zu Zeiten des Aufbaus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, waren derlei Fragen und Probleme kaum Gegenstand der fachlichen oder öffentlichen Diskussion. Im anlaufenden 21. Jahrhundert sieht das anders aus. Das Rundfunkratswesen hat darauf noch nicht reagiert.
Nun wird es (vermutlich) immer Utopie blieben, alle Strömungen und Verästelungen einer Zivilgesellschaft in einem überschaubar gehaltenen und damit effektiv arbeitsfähigem Vertretungsgremium abzubilden. Um dieses Dilemma spürbar abzumildern, gibt es aber eine erste Lösungsnäherung: den potenziellen Zugang für jeden, der Interesse hat, zu ermöglichen – durch Transparenz und Öffentlichkeit dessen, was in den Rundfunkanstalten geschieht. Ein Blick auf andere Länder, z.B. Großbritannien, zeigt, was machbar ist und was (gut) funktioniert.
Ein kleines zusammenfassendes Fazit
Wenn sich das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, gerade in Abgrenzung zum Geschäftsmodell des privaten Rundfunks, auf eine breitere Akzeptanz auch in Zukunft stützen will, so kann das nur gelingen, wenn sich die öffentliche Teilhabe durch Transparenz und Kommunikation insbesondere in jenem Gremium widerspiegelt, das den Anspruch auf Legitimität und Repräsentanz erhebt, weil es die grundsätzlichen Leitlinien für die „öffentlich-rechtliche“ Aufgabe vorgeben soll.
(JL)
Online am: 02.01.2017
Aktualisiert am: 24.11.2018
Inhalt:
Rundfunkräte als "Medienwächter"? Oder: Kontrolle ohne Kontrolleure?
Tags:
Öffentlich-rechtliches Fernsehen | WDR | mangelnde Kritik- und Fehlerkultur | Krankenhaus


